ADHS ist keine Willensfrage, sondern eine andere Steuerung von Erregung und Aufmerksamkeit. Dopamin und Noradrenalin schwanken in den frontostriatalen Netzwerken stärker; das Locus-coeruleus-System (Noradrenalin) stellt den „Lautstärkeregler“ für Reize. Bei zu wenig Aktivierung fühlen Sie sich leer und fahrig, bei zu viel kippt das System in Alarm. Entspannung heißt: den Regelkreis aus Sympathikus (Gas) und Parasympathikus/Vagus (Bremse) ins mittlere, handlungsfähige Fenster zurückführen.
Manchmal enthalten die einfachsten Momente die tiefste Weisheit. Lassen Sie Ihre Gedanken zur Ruhe kommen, und die Klarheit wird Sie finden. Verwenden Sie diesen Zitatbereich, um etwas Inspirierendes oder Nachdenkliches zu teilen, das perfekt zum Thema Ihres Artikels passt.
Warum klassische Methoden oft scheitern
Lange, stille Meditationen verlangen kognitive Kontrolle – die bricht unter Stress zuerst weg (präfrontaler Kortex „geht offline“). Körper-Scans ohne Reizwechsel langweilen; das Gehirn driftet in Grübelschleifen. „Setz dich hin und beruhige dich“ überfordert, wenn die innere Spannung hoch ist.


Was typischerweise funktioniert
Kurz, körpernah, rhythmisch, klar dosiert. Propriozeptiver Druck (Spannung auf Muskeln/Sehnen) liefert starke Körpersignale und senkt den inneren Lärm. Gleichmäßige Bewegung synchronisiert Atmung und Herz (respiratorische Sinusarrhythmie). Temperaturreize (kühl/warm) modulieren das autonome Nervensystem. Weite des Blicks signalisiert Sicherheit. Und: weniger Input (Benachrichtigungen, Tabs, Lärm) senkt die Grundlast.
Eine Übung als Beispiel: der physiologische Seufzer (≈90 Sek.)
- Durch die Nase einatmen; am Ende ein kurzes zweites Einatmen hinzufügen.
- Langsam durch den Mund ausatmen, bis die Lunge „leer“ wirkt.
- Drei–fünf Durchgänge.Warum es wirkt: Das doppelte Einatmen dehnt die Lungenbläschen, das lange Ausatmen reduziert CO₂ und erhöht kurzfristig den Vagustonus. Puls sinkt, der präfrontale Kortex bekommt wieder „Online-Zeit“. Wichtig: nicht forcieren, keine Hyperventilation.
Fehlerquellen – warum manches nicht greift
– Zu lang/zu komplex: Besser 30–90-Sekunden-Dosen.
– Nur „im Kopf“: Selbstgespräche ohne Körpersignal sind unter hoher Erregung zu schwach.
– Reizflut bleibt: Atmen hilft weniger, wenn Handy, Lärm und grelles Licht weiterballern.
– Perfektionsanspruch: Ziel ist nicht Zen, sondern 10–30 % weniger Anspannung – genug für den nächsten Schritt.
– Timing: Direkt nach Koffein, Zucker oder Social-Media-Dopamin ist die Regelbarkeit schlechter.
So verankern Sie Entspannung
Zwei Quick-Wins wählen (z. B. Seufzer + Blickweitung) und an Anker koppeln: vor dem Postfach, nach Meetings, vor dem Schlafen. Sichtbare Hinweise (Theraband, Post-it „90 Sek. Atmen“) helfen. Wirkung auf einer 0–10-Skala messen: Sinkt die Anspannung um ≥1 Punkt, war die Methode wirksam.
Klartext
An Tagen mit starker Angst/Depression/Traumafolgen reichen Selbsthilfen nicht – dann gehört professionelle Unterstützung dazu. Für den Alltag liefert der Mix aus kurzen Atem-, Druck- und Rhythmusimpulsen robuste Werkzeuge. Nicht perfekt, aber zuverlässig genug, um wieder handlungsfähig zu werden.
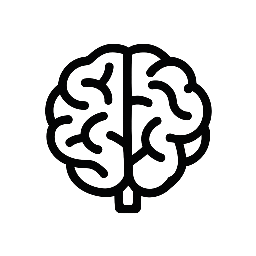
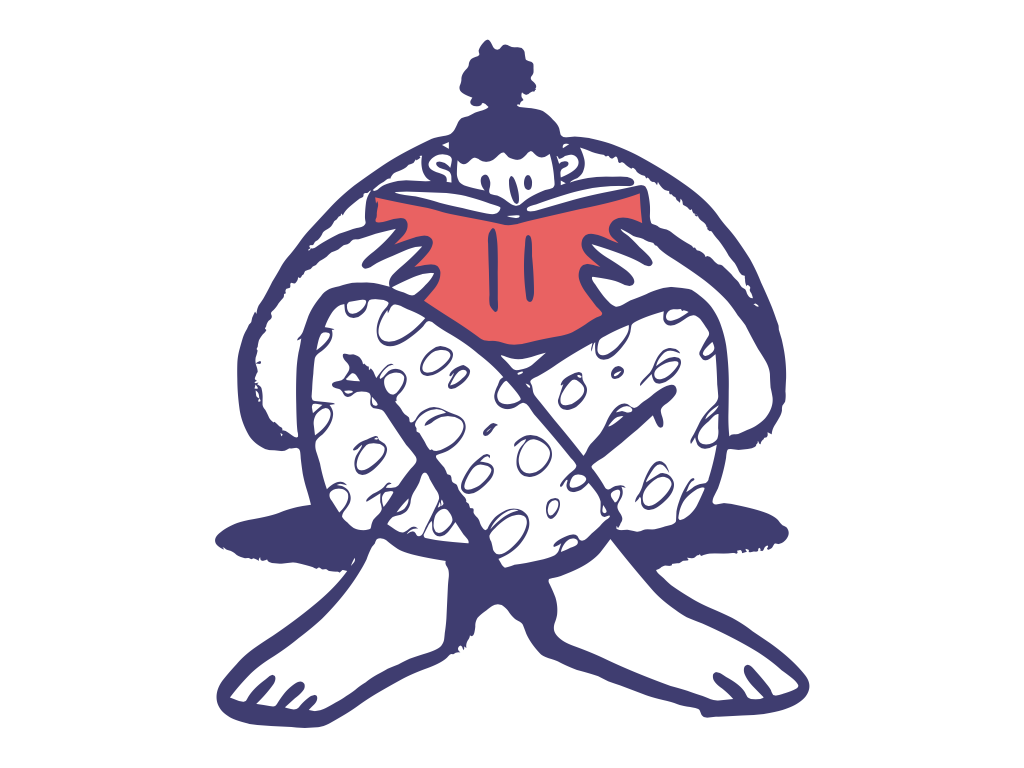
Schreibe einen Kommentar